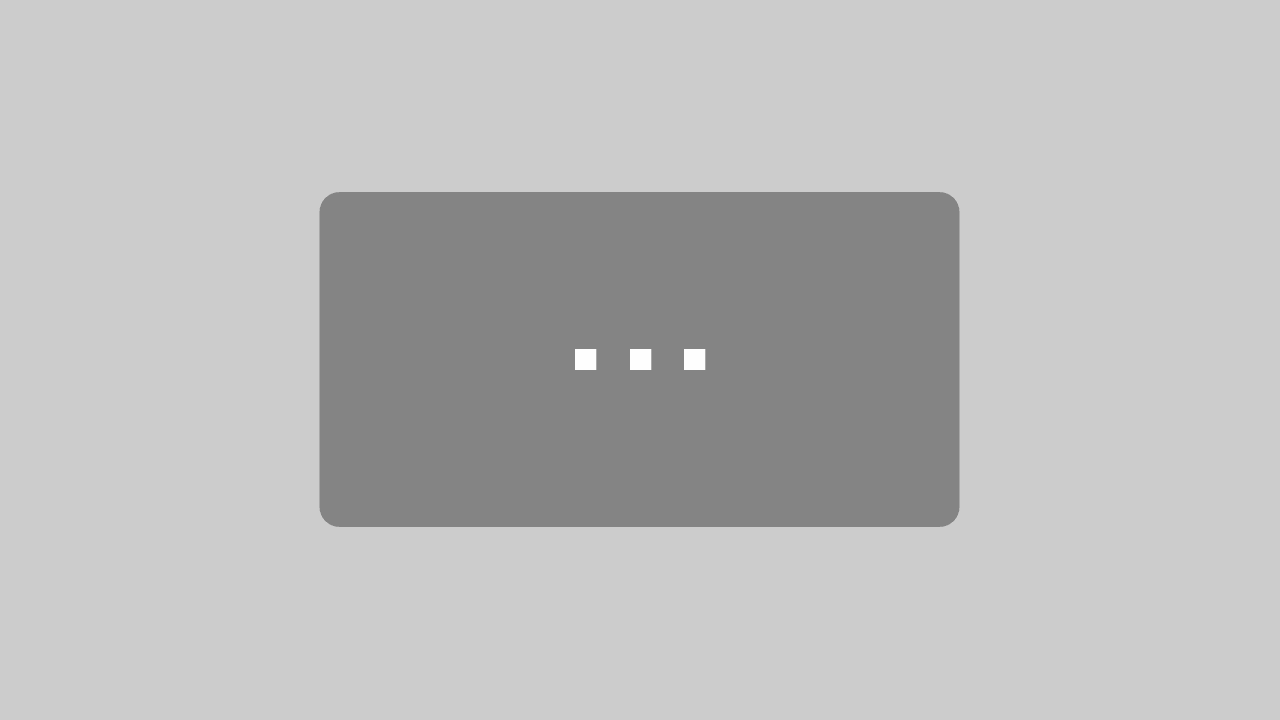Thema Medienbildung »
Geschichten aus dem Internet
An Themen, über die ich im medienpädagogischen Kontext mit Kinder und Jugendlichen reden kann, scheitert es nun wirklich nicht. Viel anspruchsvoller gestaltet sich eher der entsprechende Einstieg für die jeweilige Zielgruppe.
Mit den „Geschichten aus dem Internet“ habe ich nun wieder neue Zugänge in Form von Comics für Kinder und jüngere Jugendliche gefunden. Das schweizer Bundesamt für Kommunikation BAKOM hat mit diesem Angebot eine Vielzahl an medienpädagogischen Themen in Comic-Geschichten rund um die Familie Webster gepackt, die vor den typischen Herausforderungen und Problemen der Medienwelt stehen, wie z.B. Phishing, Mobbing, Malware, Sexting etc. Zu allen Geschichten gibt es zudem kurz und knappe Hintergrundinformationen, Verhaltenstipps und weiterführende Links. Alle Geschichten stehen in deutscher, französischer, italienischer, englischer und bündnerromanischer Sprache zur Verfügung und können entweder heruntergeladen oder auch bestellt werden.
Sechs Wege, um Falschmeldungen zu entlarven
Manchmal bin ich persönlich ziemlich schockiert, wie unreflektiert einfach mal so kontextlose Bilder, Videos und andere Meldungen auf Facebook als bare Münze genommen werden. Daher sehe ich im Bereich der Bildungsarbeit den medienkritische Umgang mit solchen Informationen als unerlässlich. Seit vielen Monaten sammele ich daher in einem Etherpad Links und Quellen, die für genau diesen Zweck genutzt werden können.
Zu dieser Liste ist nun ein neuer Link von den Netzpiloten hinzugekommen, die in einem Artikel sechs Wege aufzeichnen, um Falschmeldungen zu entlarven. Natürlich bieten diese Wege keine 100 prozentige Sicherheit, die Originalquelle eines Mediums aufzuzeigen, dennoch werden hier Strategien angeboten, die ersten Schritte in die richtige Richtung zu gehen.
Tagungs-Dokumentation: „Ein Netz für alle. Potentiale einer inklusiven Medienbildung“
Inklusion ist heutzutage ein gern genutztes Buzzword geworden: Viele reden darüber, alle halten sie für selbstverständlich – doch wann und wo wird sie eigentlich konkret umgesetzt? Wie schwer die Inklusion im alltäglichen Reden und Handeln fällt zeigt beispielsweise das vielzitierte Rollstuhlfahrer-Bullshit-Bingo plakativ auf.
Auch wir in der (Medien-)Bildung und Jugendarbeit müssen uns der Frage nach Inklusion selbstkritisch stellen, da leider nur wenige Anbieter und Angebote wirklich inklusiv gestaltet sind. Das zeigt sich nicht nur an Schulen oder Jugendzentren ohne Aufzug, sondern auch an nicht-barrierefreien Websites und Ausschreibungen, die nicht in einfacher Sprache verfasst sind.
Die jährliche Fachtagung „Gautinger Internettreffen“ widmete sich daher diesmal dem Thema „Inklusion in der Medienbildung“. Am 17. und 18. März 2015 kamen rund 90 Fachkräfte aus Schule, Medienpädagogik und Jugendarbeit in Gauting zusammen, um unter dem Titel „Ein Netz für alle“ die Potentiale und Chancen einer inklusiven Medienbildung zu erörtern.
Eine ausführliche Online-Dokumentation der Fachtagung hält nun Videos, Fotos, Präsentationen und Materialien bereit, die Videoaufzeichnungen der Vorträge sind auch in Gebärdensprache verfügbar. Den ganzen Beitrag lesen
Phrasen dreschen rund um Medien(pädagogik)
Rund um Medien und Pädagogik wird aktuell landauf, landab viel diskutiert und das soll auch so sein. Gelegentlich klaffen aber doch – gerade in der Bildungspolitik – Worte und Taten auseinander und wer länger hinhört, bekommt den Eindruck, immer wieder das gleiche zu hören, aber nicht immer Taten zu sehen.
Der «Blahfaselgenerator» von Beat Döbeli macht bewusst, wieviele Phrasen rund um die Medienpädagogik aktuell gedroschen werden – und motiviert, genauer hinzuschauen, welche Konsequenzen denn folgen. Insofern eine wertvolle, augenzwinkernde und durchaus selbstironische Ressource für Referate und Diskussionsrunden in der Medienpädagogik und Bildungspolitik. Einzig optisch bzw. in der Usability könnte der Blahfaselgenerator noch etwas gepimpt werden, denn es ist nicht unbedingt klar, wie neue Phrasen zustande kommen. Ein simpler Reload der Seite hilft aber.
Im zugehörigen Blogpost gibt Beat Döbeli der Idee der digitalen Phrasendreschmaschine noch eine weitere Ebene: Er meint, dass der Blahfaselgenerator auch eine Inspiration sein kann, im Sprachunterricht selbst eine ähnliche Anwendung nachzubauen – und sich damit gleichzeitig mit Informatik und Sprachstrukturen auseinanderzusetzen. Eine gute Idee – und auch das zugrundeliegende Anliegen stimmt: Informatik darf sich nicht nur mit Zahlen und mathematischen Gegenständen beschäftigen.
Quiz Your Web – Teste dein Internet-Wissen
Viele kennen das Prinzip von Quiz-Duell, einer App, in der mensch nach erfolgreicher Anmeldung sein allgemeines und spezielles Wissen mit anderen bekannten und unbekannten Personen messen kann. Dieses Prinzip wurde nun erfreulicherweise von der Fachstelle für internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e.V. (IJAB) aufgegriffen und in einer eigenen Quiz-App rund um das Thema Medienkompetenz umgesetzt. QuizYourWeb nennt sich das neue Angebot und ist für iOS und Android kostenlos erhältlich.
Ich selbst habe App ein paar mal gespielt und finde sie ganz gut gemacht. Auch wenn manchmal die möglichen Antworten sehr lang sind und man sich für das Lesen in der vorgegebenen Zeit sehr beeilen muss, ist die App doch ein spielerischer und inhaltlich umfangreicher Einstieg ins Thema. Dadurch, dass man sich seine Gegner auch selbst aussuchen kann, ist auch der Einsatz im Jugendtreff, in der Familie oder als medienpädagogische Einheit durchaus möglich und sinnvoll.
Medienbildung an Schulen in Deutschland
«Mehr Medienkompetenz» fordern mittlerweile fast alle. Was darunter verstanden wird, ist dagegen sehr unterschiedlich – und was getan wird erst recht. Das zeigt sich auch in der Untersuchung «Medienbildung an deutschen Schulen» der «Initiative D21», die kürzlich erschienen ist. Darin nehmen die Macher_innen eine recht aufwändige Bestandsaufnahme der Aktivitäten und Strukturen auf Bundes- und Landesebene vor.
Plakatives Kernergebnis der Studie ist eine Übersicht bzw. Kategorisierung der Bundesländer in solche die viel, weniger und kaum Medienbildung an Schulen (strukturell) fördern. In der Publikation ist aber noch einiges mehr zu finden:
- Lehrplanauszüge für alle Bundesländer, die sich auf das Thema beziehen
- eine Übersicht von Akteur_innen, Maßnahmen und Strukturen in den einzelnen Ländern
- generelle Rahmenbedingungen des Schulsystems, auch auf internationaler Ebene
Die Studie liefert daher auch über das Kernthema hinaus einen guten Einblick in den Status Quo und die Entwicklungslinien des Schulsystems in Deutschland.
Grundlage der Untersuchung ist allerdings eine Recherche auf Bundes- und Länderebene nach öffentlich verfügbaren Informationen, ergänzt durch Interviews mit Akteur_innen, was zunächst keine sonderlich breite Basis darstellt. Die Autor_innen führen die eigenen Erkenntnisse jedoch mit denen weiterer Studien im Schulfeld, etwa zur Lehrpersonenausbildung, zusammen, was ein recht breites Bild ergibt.
Eine Publikation einer Interessenorganisation muss selbstverständlich mit eigenen Forderungen zum Thema enden. Aber auch hier sticht die Publikation erfreulich hervor, denn diese basieren gleich auf mehreren Forderungspapieren zum Thema Medienbildung aus dem Bildungsbereich, etwa von «Keine Bildung ohne Medien».
Medienbildung im digitalen Zeitalter
Medienbildung ist ein Konzept für eine stark von Medien geprägten, digitale Gesellschaft. Und so stark wie die Gesellschaft sich mit Mediatisierung verändert, umso populärer wird auch Medienpädagogik. Nicht selten bleibt dabei aber die begriffliche Klarheit auf der Strecke.
Thomas Merz und Mareike Düssel setzen sich aktuell in einer kostenlosen Broschüre mit «Medienbildung im digitalen Zeitalter» auseinander. Dabei schärfen sie den Begriff, skizzieren Hintergrund und Reichweite des Konzepts und stellen das Handlungsfeld dar. Den Autor_innen gelingt dabei die schwierige Gratwanderung zwischen Kürze und inhaltlicher Tiefe sehr gut – was das kostenlose PDF zu einer guten Handreichung für Neulinge im Bereich der pädagogischen Arbeit mit Medien macht. Diskussionswürdig ist meiner Meinung nach einzig der Schluss der Publikation, wo es um das Verhältnis zur Informatik geht – und eine scharfe Trennung inhaltlich nicht unbedingt geboten.